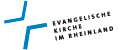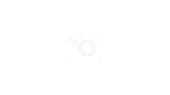Und... LICHT

Die Ausstellung „Und … LICHT“ der Evangelischen Kirche im Rheinland war von Frühjahr 2019 bis März 2020 in neun Kirchen zu sehen.
Die Ausstellung

Die Wanderausstellung „und … Licht“
hatte das Ziel, den Dialog zwischen Theologie und Lichtkunst zu vertiefen.
Sieben international renommierte Künstlerinnen und Künstler haben Werke für die
Ausstellung geschaffen, die sich mit dem Thema Licht befassen, christliche
Botschaften beleuchten und hinterfragen.
Die
Ausstellung war 2019 in sieben Städten auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche
im Rheinland zu sehen: in Düsseldorf, Essen, Trier, Krefeld, Mönchengladbach,
Troisdorf und Saarbrücken.
Die Kunstwerke

2+1 (molitor & kuzmin)
aeon (Konstantinos Angelos Gavrias)
falling lights and rising shadows (krüger prothmann)
Lichtzeit
(molitor & kuzmin)
m&k-Licht-2000
(molitor & kuzmin)
Shine on... (Christoph Dahlhausen)
Spiritus Sanctus (Diana Ramaekers)
Stellare Verbindungen (Christoph Dahlhausen)
Welle (
(molitor & kuzmin)
(molitor & kuzmin) 2+1



Das Objekt besteht aus Betonplatten, in die runde
Öffnungen eingearbeitet sind. Leuchtringe umgeben die drei bullaugenförmigen
Öffnungen, durch die Betrachter hindurchschauen können. Die Ringe sind
asymmetrisch zueinander angeordnet und treten leicht erhaben aus dem Beton
hervor. In die massiven Betonplatten sind Moniereisen eingearbeitet, deren
Enden aus den Platten herausragen. Teilweise entsteht der Eindruck von Kreuzen,
die das Werk umgeben.
Im Kontext der Kirchen als Ausstellungsorte tritt das Werk in Bezug zur christlichen Dreieinigkeitslehre, nach der sich Gott in drei Gestalten zeigt: als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn Gott aber in drei Seinsweisen existiert, warum ist ein Leuchtring separat auf einer Betonplatte platziert – abgetrennt von den anderen beiden Ringen? Hat sich der Vater vom Sohn gelöst? Geht der Heilige Geist seinen eigenen Weg? Zerfällt die Dreieinigkeit? Das deuten die Brüche und Risse im Beton an.

Alle drei Ringe haben den gleichen Durchmesser und
strahlen gleichermaßen hell im Licht; ein Hinweis auf ein gleichberechtigtes Nebeneinander.
Es entsteht der Eindruck, als schauten die Bullaugen den Betrachter unmittelbar
an. Die Ringe sind durchsichtig. Immaterielles und Materielles treten in
Beziehung zueinander.
Aufgrund der rauen und einfachen Materialien
erinnert das Objekt an Werke der „Arte Povera“ – eine stilprägende Richtung der
Nachkriegskunst in Italien, bei der ärmliche Materialien sowie
Alltagsmaterialien künstlerisch verwendet werden.
Ein Werk von molitor & kuzmin
(Konstantinos Angelos Gavrias) aeon



Plötzlich ist er da, wie aus dem
Nichts erschienen, gar auferstanden? Oder war er nie fort? Die Fotografie von
Konstantinos Angelos Gavrias zeigt ein Selbstporträt des Künstlers. Aus der
Ferne ist eine mattweiße Fläche zu sehen, konturlos, ohne Zeichnung. Erst aus
der Nähe, unter besonderem Lichteinfall, treten die Umrisse eines Mannes
hervor, der den Betrachter aus einer anderen Sphäre anzuschauen scheint. Als
würde er aus dem Rahmen fallen und vom Jenseits in die diesseitige Welt
eintreten.
Der Titel des Werkes verweist auf
das griechische Wort „aeon“, das im Deutschen unterschiedliche Bedeutungen hat
und unter anderem übersetzt werden kann als Lebenszeit, Leben, Zeit, Zeitraum
oder Ewigkeit. Nach Angaben des wissenschaftlichen Bibellexikons der Deutschen
Bibelgesellschaft übersetzte Martin Luther „aeon“ 37 Mal mit „Welt“ und 75 Mal
mit „Ewigkeit“ oder „ewig“ beziehungsweise „ewiglich“; je einmal verwendete er
das Wort „Lauf“, „vorzeiten“ und „Zeit“.

Im christlichen Kontext wird „aeon“ oft
mit apokalyptischen Implikationen verwendet. Etwa in der Verkündigung Jesu vom
anbrechenden Reich Gottes. „Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe
herbeigekommen“, heißt es im Markusevangelium (1,15), wobei „aeon“ in diesem Fall
mit „Zeit“ übersetzt wurde. „Tut Buße und glaubt an das Evangelium!“, steht im
gleichen Bibelvers.
Wie eine mahnende Erinnerung an den
nahenden Messias erscheint Gavrias Werk in diesem Kontext. Oder als Forderung,
sich im Hier und Jetzt für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der
Schöpfung einzusetzen.
Ein Werk von Konstantinos Angelos
(krüger prothmann) falling lights and rising shadows



Bewegte Bilder erscheinen bei der Installation des
Künstlerduos Krüger und Prothmann auf Kirchwänden und treten in Interaktion mit
der Architektur sakraler Räume. In filmischen Sequenzen sind Fragmente von
Hell-Dunkel-Formationen zu sehen, die in einer Endlosschleife auf Wände
projiziert werden und vielfältige Assoziationen zulassen: Schatten wandern,
steigen auf, verschwinden und machen Platz für Lichtstrahlen, die sich in
bewegendem Wasser brechen und auffächern. Licht und Schatten erscheinen wie
eine Einheit, untrennbar, einander bedingend.
Der Titel des Werks „falling lights and
rising shadows“ (dt. „Sinkende Lichter und aufsteigende Schatten“) deutet an,
dass die aufsteigenden Schatten die Oberhand behalten könnten. Als Drohung vor
nahendem Unheil? Gebärden finsterer Mächte?

Schatten bieten auch Schutz und
Zuflucht. In Psalm 36,8 ist zu lesen: „Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass
Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!“ An anderer
Stelle spricht Gott: „Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und habe dich
unter dem Schatten meiner Hände geborgen.“ (Jesaja 51,16) Zudem verweisen
Schatten im biblischen Kontext auf die Vergänglichkeit des Menschen: „Der
Mensch gleicht dem Hauch (o. Dunst). Seine Tage sind wie ein vorübergehender
Schatten.“ (Psalm 144,4).
Die Lichtverhältnisse und
Projektionsflächen unterscheiden sich von Kirche zu Kirche. Wände, auf die
bewegte Bilder projiziert werden, sind mal eben, mal grob, und unterschiedlich
strukturiert. Die filmischen Sequenzen erzielen daher von Ort zu Ort
einzigartige Wirkungen.
Ein Werk von krüger prothmann
(molitor & kuzmin) LichtZeit



Wenn es schnell gehen muss, ist
Lichtgeschwindigkeit das Maß der Dinge. Mit 299 792 458 Metern pro
Sekunde oder rund einer Milliarde Kilometer pro Stunde geht es voran. Von der
Erde aus erreicht man in acht Minuten die Sonne. Was aber, wenn sich Zeit und
Licht konträr zueinander entwickeln? Wie verhalten sich Licht und Zeit
überhaupt zueinander?
Fragen und Gedanken wie diese wirft
die Lichtinstallation „LichtZeit “ auf. Sie zeigt den Titel des Werkes mit
einem Neonschriftzug, der über einem Untergrund aus Filz angebracht ist. Das
Wort „Licht“ ist von links nach rechts zu lesen, das Wort „Zeit“ entgegen der
Lesegewohnheit von rechts nach links. Zudem ist das Wort „Zeit“ auf den Kopf
gestellt. „Licht“ und „Zeit“ treten in eine konträre Beziehung zueinander: Das
Licht läuft der Zeit entgegen, die Zeit kollidiert mit dem Licht. Was mag das
bedeuten?

Albert Einstein hat das Verhältnis von
Licht und Zeit erforscht. In seiner Relativitätstheorie legt er dar, dass die
Zeit langsamer vergeht, je schneller man sich bewegt. Ist es also möglich, das
Vergehen der Zeit anzuhalten, wenn man in Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist?
Kann der Mensch ewig leben, wenn er sich nur schnell genug bewegt? Fragen
über Fragen.
Kohelet, der Prediger, sieht es
gelassener, wenn er schreibt: „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben
unter dem Himmel hat seine Stunde: Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat
seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine
Zeit.“ (Prediger 3,1–4)
Ein Werk von molitor & kuzmin
(molitor & kuzmin) m&k-Licht-2000



Träume in den Sand schreiben – das
können Besucherinnen und Besucher beim Objekt „m&k-Licht-2000“. Es besteht
aus einer Stele, die auf einem betretbaren Sockel angebracht ist. Am oberen
Ende befindet sich eine Bleikiste, in die feiner Quarzsand auf einer
geschwungenen Leuchtstoffröhre verstreut ist. Besucherinnen und Besucher der
Ausstellung sind aufgefordert, sich mit dem Lichtobjekt auseinanderzusetzen.
Sie können die warme Lichtquelle berühren, den Sand formen und nach eigenen
Vorstellungen gestalten.
Das Werk thematisiert das Werden und
Vergehen und die Suche nach Licht. Je nachdem, wie der Sand verteilt ist,
entstehen unterschiedliche Formen und Wirkungen des Lichts. Mal ist ein
Halbmond, mal ein leuchtender Ring im Sand erkennbar. Verstreut man den Sand
ganz über die Leuchtröhre, verschwindet das Licht.

Der Wahl der Materialien kommt eine
besondere Bedeutung zu: Während Blei mit Schwere, Bodenhaftigkeit und
Beständigkeit assoziiert ist, wirkt Licht in Kombination mit dem sich
verändernden Sand wie etwas Unbeständiges.
Die Kombination von Sand und Licht weckt
auch biblische Assoziationen: Gott erschien Moses der biblischen Erzählung
zufolge in einer Feuerflamme aus einem brennenden Dornbusch. „Ich bin der, der
ich bin“, sagt die Stimme zu Moses. Gott lässt sich demnach nicht auf ein Bild
oder eine Erscheinungsform verlegen.
Ein Werk vom molitor & kuzmin
(Christoph Dahlhausen) Shine on …



Das englische Wort „shine“ hat im
Deutschen mehrere Bedeutungen. Es kann mit Glanz, Schein, Brillanz, Strahlen
oder Leuchten übersetzt werden. Der Titel der Lichtinstallation „Shine on …“
lässt sich daher auch als Aufforderung verstehen: „Leuchte weiter“ oder „Leuchte
auf“. Offen bleibt, ob das leuchtende Objekt oder der Betrachter das Licht
weitergeben soll – möglicherweise auch beide.
Die Installation besteht aus
Verstrebungen von Baugerüsten und Leuchtstoffröhren, die an den meisten
Ausstellungsorten an Kirchportalen angebracht sind. Die Verstrebungen rahmen
Eintrittspforten in die Welt des Sakralen oder aus ihr hinaus. Die
dekonstruktivistische Anordnung des Gerüstes und die Anmutung einer Baustelle
verweist auf die Ambivalenz von Fragilem und Stabilen. Das Orthogonale und
Ordentliche wird aufgebrochen.

Das Licht der Leuchtstoffröhren
erscheint in einem Blauton, der an Zyanblau erinnert, in der Natur kaum
vorkommt und auf Übernatürliches hindeutet. Häufig steht die Farbe Blau in der
Kunst für das Ferne, für Vertiefung und das Geistige. In seiner Abhandlung
„Über das Geistige in der Kunst“ (1912) schreibt der Künstler Wassily Kandinsky
daher: „Je tiefer das Blau wird, desto mehr ruft es den Menschen in das
Unendliche, weckt in ihm die Sehnsucht nach Reinem und schließlich
Übersinnlichem. Es ist die Farbe des Himmels, so wie wir ihn uns vorstellen bei
dem Klange des Wortes Himmel.“
Ein Werk von Christoph Dahlhausen
(Diana Ramaekers) Spiritus Sanctus



Manche halten ihn für eine Kraft,
unsichtbar, die alles durchdringt, ein Lebenshauch. Andere für eine Quelle der
Inspiration, von der schöpferische Impulse ausgehen. An Definitionen, was der
Heilige Geist sein könnte, arbeiten sich Gelehrte seit Jahrtausenden ab. Auch
Diana Ramaekers leistet einen Beitrag – freilich als Künstlerin, die Denkräume
eröffnet und Raum für Interpretationen bietet. Der Heilige Geist habe schon
seit jeher die eigene Fantasie beflügelt, „weil er ungreifbar, abstrakt und
schwer zu deuten ist“, sagt sie.
Ihre Installation „Spiritus
Sanctus“ (dt. „Heiliger Geist“) zeigt drei aus flachem Glas angedeutete
Wasserlachen, die bläulich schimmern und Licht – je nach Perspektive –
regenbogenfarben reflektieren; als berühre der Heilige Geist sanft das Wasser
mit einem flirrenden Schleier. Ein Moment der Erkenntnis? Ein Geistesblitz?

Auch eine physikalische
Beschreibung ist möglich: Interferenz nennen Physiker das Phänomen, bei dem
sich Lichtreflexionen überlagern, um sich zu verstärken oder auszulöschen. Auf
diese Weise entsteht das sogenannte Interferenzlicht. Man kann es in der Natur
beobachten: beim regenbogenfarbenen Schillern von Perlen, von Seifenblasen oder
einem Ölschleier auf Wasser.
Im deutungsoffenen Werk steht Wasser
auch als Metapher für das Leben. Davon erzählt auch die Bibel. „Und wen
dürstet, der komme; wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.“
(Offenbarung 22,17)
Ein Werk von Diana Ramaekers
(Christoph Dahlhausen) Stellare Verbindungen



Das Werk besteht aus Fotofiltern und Fotolinsen, die
in einer Aluminiumscheibe befestigt sind. Ein Lichtprojektor strahlt die sich
geringfügig drehende Scheibe an und wirft farbiges Licht in sich verändernden
Konstellationen auf Wände, Kanzeln oder andere Raumelemente – ein möglicher
Hinweis auf Projektion in Religion und Psychologie. Mit Ludwig Feuerbach, dem
Philosophen und Religionskritiker, gesprochen: „Was er (der Mensch) selbst
nicht ist, aber zu sein wünscht, das stellt er sich in seinen Göttern als
seiend vor.“
Von Augenblick zu Augenblick
verändern sich die stellaren Verbindungen. Sie erscheinen in variablen
Konstellationen auf den Projektionsflächen der Kirchen und erinnern an einen
bunten Sternenhimmel oder eine blühende Blumenwiese. Verbirgt sich ein
göttliches Licht hinter den Abbildungen und Projektionen?

Die Frage nach dem möglichen spirituellen
Hintergrund wird kontrastiert durch die Sichtbarkeit des nachvollziehbar
Irdischen, zum Beispiel in der Lesbarkeit von Herstellernamen und Brennweiten
der Fotofilter aus der analogen Zeit. Alles scheint entschlüsselt sichtbar –
etwa der Strahler, die Filter und ihre frühere Funktion. Dennoch entsteht in
dem Werk in der Interaktion mit Raum und Zeit etwas scheinbar Magisches.
Dahlhausens Werk erinnert formal an das
Kirchenfenster aus farbigen Quadraten von Gerhard Richter im Kölner Dom, es
kehrt allerdings die Projektionsrichtung um.
Ein Werk von Christoph Dahlhausen
(molitor & kuzmin) Welle



Licht
und Bewegung – dieses Verhältnis greift das Objekt „Welle“ auf, bei der eine
Neonkontur in eine Rahmenkonstruktion aus Aluminium gearbeitet ist; es
vermittelt den Eindruck einer sich drehenden Lichtwelle, die sich in einer
Endlosschleife langsam bewegt. Auf der dahinter liegenden oxidierten Zinkplatte
reflektiert das blaue Licht.
Eine
meditativ-mystische Anmutung geht von dem Objekt aus; es erzeugt eine sinnliche
Atmosphäre, lässt Bilder im Kopf entstehen und wirft Fragen auf: Woher kommt
das Licht? Steht es niemals still? Ist das bewegende Licht eine Metapher für
neonhelle Gehirnströme?
In
Kirchen, in denen das Objekt ausgestellt ist, lädt es zum stillen Betrachten
und zur Meditation ein. Assoziationen des „Unbewegten Bewegers“, von dem
Aristoteles geschrieben hat, drängen sich auf. Gemeint ist eine göttliche
Quelle, auf die alle Bewegungen und Veränderungen zurückzuführen sind.

Die Mystikerin Mechthild von Magdeburg
(1207–1282) wiederum hat über das „fließende Licht der Gottheit“ geschrieben.
Licht und Bewegung erscheinen bei ihr als eine Metapher für das Göttliche. Wie
das Licht bekomme man Gott nicht zu fassen – und doch sei es in sich
verändernder Form präsent.
Wer lange genug auf die Welle schaut,
dem mögen Lichter aufgehen. Oder aber man erfreut sich ganz einfach an der
Schönheit des Lichts, das für sich genommen Grund genug ist, um ausgestellt zu
werden.
Ein Werk von molitor & kuzmin
Die Künstlerinnen und Künstler


Christoph Dahlhausen

Christoph Dahlhausen (*1960) lebt und arbeitet in Bonn und Melbourne. Er war Schüler der Violoncelloklasse von Peter Dettmar am Rheinischen Konservatorium in Köln und studierte Medizin in Bonn. Seit 1991 arbeitet er als freischaffender Künstler. Sein Augenmerk liegt auf raumbezogenen Arbeiten und Installationen sowie Kunst am Bau. Eines seiner bekanntesten und jüngeren Werke ist die Großskulptur „What if“ (2012) aus kippenden starkfarbigen Stahlstangen auf der Museumsmeile in Bonn. Dahlhausen hat eine umfangreiche weltweite Ausstellungstätigkeit. Seit 2013 lehrt er als Adjunct Professor an der Hochschule der Künste der RMIT University, Melbourne (Australien).
www.christoph-dahlhausen.de
Konstantinos Angelos Gavrias

Konstantinos Angelos Gavrias (*1978 in Unna) lebt und arbeitet in Dortmund, Athen und New York. Er studiert an der Kunstakademie Düsseldorf in der Klasse von Rita McBride. Zuvor hat der Sohn griechischer Eltern drei Jahre in New York gelebt und als Fotograf gearbeitet. Seine Fotografien und Installationen waren 2015 im Goethe-Institut in Thessaloniki und bei der Ausstellung „Maßlos“ in Düsseldorf zu sehen. Im gleichen Jahr hat sich Gavrias an der Ausstellung „Standpunkte“ zum Thema Flüchtlinge in Pulheim beteiligt. Er ist Preisträger des Kunstpreises, den die Evangelische Kirche im Rheinland im Jahr 2017 für sein Werk „Die Versuchung“ im Rahmen des Wettbewerbs „reFORMation transFORMation“ verliehen hat.
www.angelosgavrias.com
krüger prothmann

Das Künstlerduo krüger prothmann realisiert seit 2004 gemeinsame Projekte und Ausstellungen im In- und Ausland. Orte, die sie für ihre Aktionen, Installationen und Lichtarbeiten aussuchen, sind oft im Wandel: Gebäude vor dem Abriss oder vor gravierender Umwidmung, Natur in Veränderung. Das Künstlerduo thematisiert Nicht-Sichtbares, Verborgenes und Unumkehrbares als Bestandteil jeden Geschehens. Siegfried Krüger (*1954) hat Kunstgeschichte, Philosophie, Sozialwissenschaften und Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum studiert; er arbeitet seit 1984 als freischaffender Künstler. Simone Prothmann (*1971) hat Objektdesign an der Fachhochschule Dortmund studiert und arbeitet seit 2002 als freischaffende Künstlerin. Beide Künstler leben in Lünen, Westfalen.
www.krueger-prothmann.de
molitor & kuzmin

Unter dem Namen molitor & kuzmin begannen Ursula Molitor und Vladimir Kuzmin 1996 ihre künstlerische Zusammenarbeit, in deren Mittelpunkt Licht als formales und inhaltliches Kriterium steht. In groß angelegten rauminstallativen Werken sowie skulpturalen Bildkörpern visualisieren beide Künstler das Thema Licht. Ihre Arbeiten werden in Galerien, Museen, Kirchen und im öffentlichen Raum im In- und Ausland gezeigt. Beide Künstler wurden 2015 für den Internationalen Lucas-Cranach-Preis sowie den Internationalen André-Evard-Preis und 2014 für den Internationalen Light Art Award nominiert. Ursula Molitor hat Grafik/Design an der Fachhochschule Hamburg studiert und sich in Köln der Freien Malerei gewidmet. Vladimir Kuzmin hat Architektur in Moskau studiert und sich danach der Freien Malerei und Grafik zugewandt. Er lebt und arbeitet in Köln.
www.molitor-kuzmin-art.de
Diana Ramaekers

Diana Ramaekers, Jahrgang 1970, lebt und arbeitet in Kerkrade. Sie zählt zu den wenigen europäischen Künstlerinnen, die sich in den vergangenen 20 Jahren fast ausschließlich den Erscheinungsformen des Lichts gewidmet haben. Ramaekers Werk existiert im Grenzbereich von Zeichnung, Objekt und Video. In ihren Installationen und Performances gestaltet sie vorgefundene Oberflächen, Formen und Räume mit Licht neu. Ramaekers lehrt unter anderem als Dozentin an der Akademie für Medien, Design und Technologie in Maastricht.
www.dianaramaekers.com
Der Beirat

Pfarrer Stephan Dedring, Evangelische Hauptkirche, Mönchengladbach-Rheydt
Holger Hagedorn, Künstler und Kurator
Maren Kockskämper, Evangelische Kirche im Rheinland
Kirchenrat Volker König, Evangelische Kirche im Rheinland
Pfarrer Werner Sonnenberg, Kunstraum Notkirche Essen
Dr. Frank Vogelsang, Direktor der Evangelischen Akademie im Rheinland
Barbara Wengler, Johanneskirche/Stadtkirche Düsseldorf
Kontakt / Impressum

Evangelische Kirche im Rheinland
Maren Kockskämper, Referentin
Telefon: 0211-456-2408
E-Mail:maren.kockskaemper@ekir.de
Redaktion: Christina Schramm
Fotos: Andrea Dingelein, Konstantinos Angelos Gravias, Holger Hagedorn
Impressum